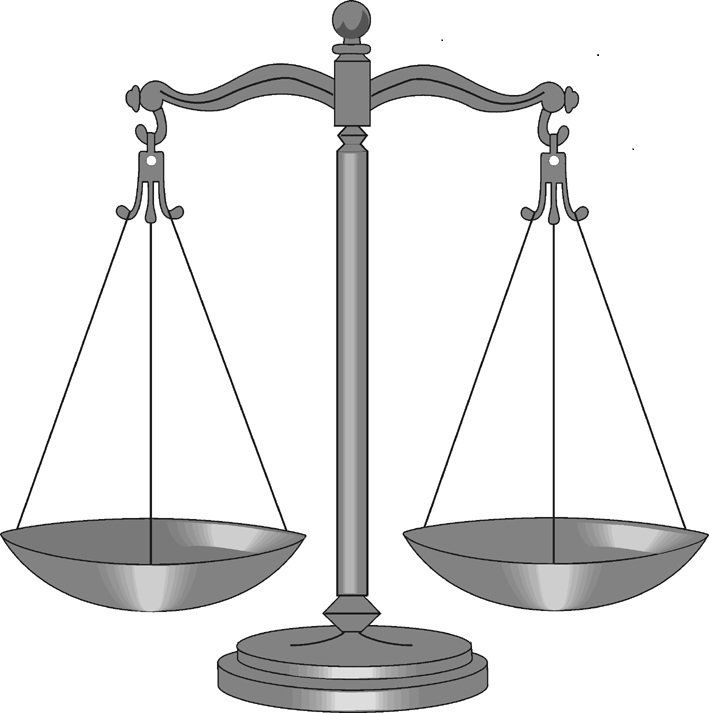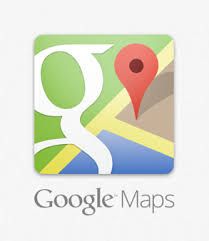Nachrichten
Super Sonderangebot
Holen Sie sich Ihren Gutschein!
Schuldnerberatungsstellen überlastet
Oft dauert es mehrere Monate, bis Ratsuchende überhaupt eine Insolvenzberatung bekommen. Und auch dann werden sie aufgund der Überlastung der Beratungsstellen, mit ihren Problemen oft allein gelassen. Teilweise wird den Schuldnern geraten, sich allein mit den Gläubigern zu einigen.
Schuldner können in diesem Fall zu einem auf Insolvenzrecht spezialisieren Anwalt gehen. Der Anwalt kann für die außergerichtliche Tätigkeit (das außergerichtliche Schuldenbereinigungsverfahren) Beratungshilfe beantragen und wird sie auch bekommen, wenn der Schuldner es zuvor erfolglos bei einer Schuldnerberatungsstelle versucht hat.
Einigung in letzter Minute: Unterhaltsvorschussgesetz ist durch!
Die Zahlungen werden künftig über das zwölfte Lebensjahr des Kindes hinaus bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gewährt. Das neue Unterhaltsvorschussgesetz tritt zum 1. Juli 2017 in Kraft.
Serviceliste
-
BGH: Auch Großeltern können zu Unterhalt verpflichtet sein
Auch Großeltern müssen unter Umständen Unterhalt für ihre Enkelkinder zahlen, wie ein aktuelles Urteil des Bundesgerichtshofes zeigt. Wenn Oma und Opa über ein entsprechend hohes Einkommen verfügen, können Elternteile von der sogenannten gesteigerten Unterhaltspflicht befreit werden, wonach bei minderjährigen Kindern weniger Selbstbehalt zum Leben bleibt. Der BGH verwies auf das Prinzip der generationenübergreifenden Solidarität.
-
Eigenmächtiger Umzug - die Macht des Faktischen: Eile ist geboten
++ OLG Saarbrücken vom 25.5.2011, 6 UF 76/11 ++
In Fällen eigenmächtigen Verbringens eines Kindes durch einen Elternteil aus seinem bisherigen Lebenskreis in eine neue Umgebung ist ein sorgerechtliches Eilverfahren besonders zu beschleunigen, um zu verhindern, dass der eigenmächtig handelnde Elternteil aus einer sonst dadurch entstehenden, von ihm ertrotzten Kontinuität ungerechtfertigte Vorteile ziehen und dem anderen Ehegatten allein dadurch effektiver Rechtsschutz versagt bleiben kann.
Tritt in solchen Fällen im Laufe des Eilverfahrens ein Zielkonflikt zwischen dem Erfordernis besonderer Beschleunigung des Verfahrens einerseits und einer eigenständigen Interessenvertretung des Kindes andererseits auf, so kann im Eilverfahren von der Bestellung eines Verfahrensbeistandes abgesehen werden, wenn ansonsten eine Verfahrensverzögerung zu befürchten ist.
-
Zustimmung zum Umzug konkludent möglich
Nach einer Trennung in Italien nahm die Mutter das knapp zweijährige Kind mit in ihre deutsche Heimat zurück. Zuvor hatte sie sich darüber mit dem Vater per SMS ausgetauscht. Ein ausdrückliches „Veto“ des Vaters gegen den Umzug nach Deutschland ließ sich daraus nicht herauslesen. Das legte das OLG Hamm als „konkludente Zustimmung“ aus. Der Rückführungsantrag des Vaters nach dem HKÜ wurde abgelehnt. Es fehle im vorliegenden Fall an Umständen, denen die Kindesmutter entnehmen musste, dass der Vater einer Ausreise der Tochter widersprechen wolle.
OLG Hamm, Beschl. v. 04.06.2013 - 11 UF 95/13
-
Bundestag beschließt Schuldenfreiheit nach drei Jahren für alle
Die Dauer einer Privatinsolvenz in Deutschland betrug bisher generell sechs Jahre, mit bestimmten Verkürzungsmöglichkeiten. Diese lange Zeit hielt viele Betroffene davon ab, Privatinsolvenz zu beantragen. Der Bundestag hat nun einem Gesetzesentwurf der Bundesregierung zugestimmt, der eine Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens auf drei Jahre beinhaltet.
In seiner Sitzung vom 17.12.2020 beschloss der Bundestag diese Änderung mit Wirkung für den 1. Oktober 2020.
Inhalt der Gesetzesänderung ist es, dass Privatpersonen in Deutschland alle ihre Schulden bereits nach drei Jahren verlieren und ein neues, schuldenfreies Leben beginnen können. Die Verkürzung auf drei Jahre macht die Insolvenz für viele Personen zur besten Möglichkeit, sich der Schulden sicher zu entledigen.
Zwar gibt es auch für Verfahren, die vor dem 01.10.2020 begonnen wurden, bereits die Möglichkeit, die Schuldenfreiheit schon nach drei Jahren zu erreichen. Hierfür müssen jedoch insgesamt etwa 50 % der Schulden zurückgezahlt werden (35 % der Schulden plus Gerichtskosten plus Kosten des Insolvenzverwalters). Diesen hohen Rückzahlbetrag konnten bislang nur sehr wenige Schuldner innerhalb der drei Jahre aufbringen. Aufgrund dieser Tatsache fordert unsere Kanzlei bereits seit längerem, dass die Restschuldbefreiung einheitlich nach drei Jahren eintreten muss. Dieser Forderung hat sich die EU angeschlossen und die Bundesregierung hat sie zügig umgesetzt.
-
Elternteil darf von gerichtlich geregeltem Umgang nicht einseitig wegen Corona-Pandemie abweichen
Freiwillige Quarantäne müssen beide Elternteile gemeinsam beschließen
Ein familiengerichtlich geregelter Umgang des Kindes mit dem anderen Elternteil darf ohne rechtfertigende Änderungsentscheidung des Familiengerichts nicht unter Hinweis auf die Kontaktbeschränkungen wegen der Verbreitung des Corona-Virus verweigert werden. Gegen einen Elternteil, der den Umgang gleichwohl nicht gewährt, kann ein Ordnungsgeld verhängt werden, entschied das Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG).
-
Corona-Pandemie: Flugreise ins Ausland bedarf Zustimmung von getrennt lebendem Elternteil
Eine Auslandsreise stellt angesichts der Pandemie keine Angelegenheit des täglichen Lebens mehr dar
Das Oberlandesgerichts Braunschweig hat am 30. Juli 2020 entschieden, dass die Flugreise eines getrenntlebenden Elternteils mit den gemeinsamen Kindern in der Zeit der Corona-Pandemie keine Angelegenheit des täglichen Lebens mehr ist und daher der Zustimmung des anderen mitsorgeberechtigten Elternteils bedarf.
-
Nachmittagsbetreuung Mehrbedarf des Kindes oder Aufwand des Elternteils
Die Kosten für eine Nachmittagsbetreuung, für die es an substantiiertem Vortrag für ein besonders ausgerichtetes pädagogisches Konzept fehlt, stellen keinen Mehrbedarf des Kindes dar (in Abgrenzung von üblicher pädagogisch veranlasster Betreuung in staatlichen Einrichtungen wie etwa Kindergärten, Schulen und Horten; BGH FamRZ 2018, Seite 23).
Beschluss:
Gericht: OLG Frankfurt
Datum: 14.06.2019
Aktenzeichen: 8 UF 25/18
-
Corona und Umgang
Weder der Umgangsberechtigte noch der betreuende Elternteil darf die Herausgabe des Kindes in Zeiten der Corona-Krise verweigern.
Ausgangsbeschränkungen erlauben den Kontakt zu engsten Familienmitgliedern.
Wenn sich der betreuende Elternteil oder das Kind infiziert, ist es der umgangsberechtigten Person für die nächsten zwei Wochen zuzumuten, auf das Umgangsrecht zu verzichten.
-
Insolvenz wegen Corona
Corona-Krise - Aussetzung der Insolvenzantragspflicht geplant
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat per Pressemitteilung vom 16.3.2020 angekündigt, die Insolvenzantragspflicht für durch die Corona-Epidemie geschädigte Unternehmen auszusetzen. Damit reagiert die Bundesregierung auf die aktuelle Corona-Krise, die nicht nur für uns alle zu deutlichen Einschränkungen des privaten und beruflichen Lebens führt, sondern auch weite Teile der deutschen Wirtschaft bereits gravierend beeinflusst.
-
Veröffentlichen von Kinderfotots
Leben Eltern, denen die elterliche Sorge gemeinsam zusteht, nicht nur vorübergehend getrennt, so ist bei Entscheidungen in Angelegenheiten, deren Regelung für das Kind von erheblicher Bedeutung ist, ihr gegenseitiges Einvernehmen erforderlich (§ 1687 Abs. 1 S.1 BGB).
Bei der Veröffentlichung des Fotos des Kindes getrenntlebender gemeinsam sorgeberechtigter Eltern auf einer kommerziellen Zwecken dienenden Internetseite handelt es sich um eine Angelegenheit von erheblicher Bedeutung. Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung sind in Abgrenzung zu Angelegenheiten des täglichen Lebens im Regelfall solche, die nicht häufig vorkommen und auch deshalb in aller Regel erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes haben oder haben können und in ihren Folgen nur mit einigem Aufwand zu beseitigen sind (OLG Oldenburg, FamRZ 2018, 1517).
-
Wechsel bei Vater und Mutter: Kinder haben zwei gekürzte Ansprüche auf Sozialleistungen
Im Wechsel bei Vater und Mutter: Kinder haben zwei gekürzte Ansprüche auf Sozialleistungen
Leben Kinder, die Sozialleistungen erhalten, abwechselnd bei Mutter und Vater, ergeben sich draus zwei Ansprüche auf Regelbedarf. Diese schließen sich allerdings in zeitlicher Hinsicht aus: Es können keine Regelbedarfsansprüche für mehr als 30 Tage im Monat entstehen.
Die getrennt lebenden Eltern teilen sich das Sorgerecht für die vier gemeinsamen Kinder. Im Rahmen eines Wechselmodells leben die Kinder wöchentlich vier Tage bei der Mutter, drei Tage beim Vater. Die Mutter erhält für die Kinder Kindergeld.
Im September 2014 stellte die Mutter für sich und die Kinder einen Antrag auf Weitergewährung von SGB II-Leistungen ab Oktober. Die zuständige Behörde bewilligte Leistungen für Mutter und Kinder. Bei den Kindern berücksichtigte sie als Regelbedarf entsprechend der vier Tage pro Woche, an denen diese bei ihrer Mutter wohnen, nur vier Siebtel des gesetzlichen Regelbedarfes.
Wechselmodell mit Lebensmittelpunkt bei der Mutter
Gegen den Bescheid erhob die Frau Widerspruch und stellte Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung. Die Kürzung der Regelbedarfe der Kinder um drei Siebtel sei nicht rechtmäßig. Die Kinder hätten ihren Lebensmittelpunkt bei ihr, und sie zahle die allgemeinen Kosten ihrer Kinder. Durch die Kürzung sei dies nicht mehr zu leisten.
Die Behörde war anderer Meinung: An den Tagen, an denen sich die Kinder bei ihrem Vater aufhielten, hätten sie keinen Anspruch auf den Regelbedarf aus der Bedarfsgemeinschaft mit ihrer Mutter.
Gericht: Regelbedarf vier Siebtel zu drei Siebtel
So sahen das auch die Richter. Für die wöchentlich beim Vater verlebten drei Tage hätten die Kinder jeweils einen Sozialgeldanspruch als Mitglied einer zeitlich begrenzten Bedarfsgemeinschaft mit ihrem Vater. Im Gegenzug stünde ihnen für diese Zeit allerdings kein Sozialgeldanspruch aus der Bedarfsgemeinschaft mit ihrer Mutter zu. Im Ergebnis hätten die Kinder also zwei Ansprüche auf Regelbedarf, die unterschiedlich hoch seien und die sich in zeitlicher Hinsicht gerade ausschlössen. Insgesamt ergäben sich auch bei wechselnden Aufenthalten Ansprüche auf Regelleistungen für nicht mehr als 30 Tage monatlich.
Die Richter wiesen die Eltern außerdem darauf hin, dass sie im Rahmen der elterlichen Sorge verpflichtet seien, sich darüber zu einigen, wer welche Kosten für die Kinder übernehme.
Sozialgericht Detmold am 27. Oktober 2014 (AZ: S 18 AS 1733/14 ER)
-
Umgangsrecht: Kindeswohlgefährdung durch verbale Angriffe auf den anderen Elternteil
Umgangsrecht: Kindeswohlgefährdung durch verbale Angriffe auf den anderen Elternteil
Untergräbt der umgangsberechtigte Elternteil die Autorität des anderen gegenüber den Kindern durch Herabsetzungen und Misstrauensbekundungen, gefährdet er damit das Kindeswohl. Die Folge kann sein, dass er nur noch begleiteten Umgang mit seinen Kindern haben darf.
Die Eltern waren geschieden, die beiden gemeinsamen Töchter lebten bei der Mutter. Der Vater hatte ein Umgangsrecht. Seine Kontakte mit den Kindern nutzte er jedoch immer wieder dazu, die Mutter herabzusetzen, ihre Erziehungsfähigkeit zu bezweifeln und sein Misstrauen ihr gegenüber auszudrücken.
Das Gericht musste daher darüber entscheiden, ob und wenn ja in welcher Form der Vater zukünftig Umgang mir seinen Kindern haben darf. Das Familiengericht entschied, den Umgang in Form von Besuchs- und Telefonkontakten für die Dauer von sechs Monaten auszusetzen. Dagegen legte der Vater Beschwerde ein.
Loyalitätskonflikt für die Kinder
Die Sachverständige kam zu dem Ergebnis, dass der Vater die Kinder in einen massiven Loyalitätskonflikt treibe. Es sei sehr wahrscheinlich, dass beide Mädchen – wenn das Verhalten des Vaters sich nicht ändere – die Mutter in ihrer Erziehungsfunktion nicht mehr anerkennen würden. Darüber hinaus werde die emotionale Bindung zwischen Mutter und Kindern beeinträchtigt. Dies gefährde das Kindeswohl. Die Sachverständige plädierte deswegen für einen begleiteten Umgang für einen befristeten Zeitraum.
Umgangsrecht der Eltern
Das Oberlandesgericht kam zu dem Ergebnis, dass der Vater begleiteten Umgang mit seinen Töchtern haben dürfe. Es verwies auf das vom Grundgesetz geschützte Umgangsrecht beider Elternteile. Die Eltern seien allerdings auch zu wechselseitig loyalem Verhalten im Umgang mit ihren Kindern verpflichtet. So dürfe der Umgangsberechtigte – hier also der Vater – das Kind nicht gegen den anderen Elternteil aufhetzen, dessen Erziehung untergraben oder beeinträchtigen oder seine Erziehungsautorität in Frage stellen.
Ausschluss des Umgangsrechts versus begleiteten Umgang
Eine Einschränkung des Umgangsrechts sei nur dann gerechtfertigt, wenn der Schutz des Kindes dies erfordere, das heißt, um eine Gefährdung seiner seelischen oder körperlichen Entwicklung abzuwehren. Es müsse immer geprüft werden, ob unter dem Aspekt der Verhältnismäßigkeit ein begleiteter Umgang des Kindes in Betracht komme, denn das sei im Vergleich zu einem Ausschluss des Umgangsrechts das mildere Mittel.
Vor diesem Hintergrund könne das Gericht im vorliegenden Fall dem Vater begleitete Umgangskontakte gewähren. Der Einschätzung der Sachverständigen, das Gesamtverhalten des Vaters sei kindeswohlgefährdend, schlossen sich die Richter an. Dennoch: Solange die Maßnahme eines begleiteten Umgang ausreiche, um das Kindeswohl sicherzustellen, dürfe man diesen nicht unterbinden. Die Begründung, der Vater verbessere sein Verhältnis zur Mutter nicht, reiche nicht aus. Eine Unterbindung des Umgangs würde das Elternrecht des Vaters unverhältnismäßig hintansetzen und beträfe auch die Kinder in ihrem eigenen Anspruch auf Umgang mit ihrem Vater.
Saarländisches Oberlandesgericht am 14. Oktober 2014 (AZ: UF 110/14)
-
Kindesunterhalt: Schätzung der Höhe des erzielbaren Einkommens
(red/dpa). Minderjährige Kinder haben gegenüber ihren Eltern Anspruch auf Kindesunterhalt. Dieser Pflicht können sich die Eltern nicht dadurch entziehen, dass sie erwerbslos sind und sich nicht um eine Arbeit bemühen. In solchen Fällen kann das Gericht ein fiktives Einkommen schätzen. Ein gesunder arbeitsfähiger Vater mittleren Alters ohne formelle Berufsqualifikation könnte etwa als Bauhelfer arbeiten. Demnach kann ein erzielbares Nettoeinkommen von rund 1.280 Euro zugrunde gelegt werden, so das Oberlandesgericht Celle.
Vater zahlt keinen Unterhalt
Die minderjährige Tochter verlangte von ihrem Vater Unterhalt. Die Eltern waren getrennt und der Vater bezog Hartz-IV-Leistungen. Er meinte, er könne keinen Unterhalt zahlen, da er nicht berufstätig sei . Er sei zeitweise selbstständig gewesen und hätte monatlich lediglich 800 Euro eingenommen. Dies hätte gerade die Kosten gedeckt. Daraus zog er den Schluss, dass er bei realistischer Betrachtung allenfalls Einkünfte in Höhe seines Selbstbehaltes erzielen könnte. Das heißt, wäre er berufstätig, würde er nicht mehr verdienen, als er sowieso selbst behalten dürfte. Der Mann hat mit seiner Lebensgefährtin ein weiteres Kind. Dass er sich um Arbeit bemühte, ließ er nicht erkennen.
Einkommen kann geschätzt werden
Das Gericht bestätigte die Entscheidung der Vorinstanz, die den Vater zu Unterhaltszahlungen verpflichtet. Da er für die Tochter unterhaltsverpflichtet sei, müsse er „in jeder ihm möglichen und zumutbaren Art und Weise zu deren (Mindest-) Unterhalt beitragen“.
Da der Mann nicht nachwies, dass er Arbeit suchte und warum er bis zu diesem Zeitpunkt erfolglos gewesen war, konnte das Gericht ein mögliches Einkommen zugrunde legen. Das heißt, es geht nicht um die tatsächliche Leistungsfähigkeit des Mannes, sondern darum, welches Einkommen er erzielen könnte. Er habe zwar keine Ausbildung, sei aber gesund und arbeitsfähig, so das Gericht. Er könne daher etwa als Bauhelfer arbeiten. Damit ließe sich ein Einkommen von rund 1.280 Euro erzielen. Da bei der Berechnung der Unterhalts auch zu berücksichtigen sei, dass er ein weiteres Kind habe, könne er monatlich noch etwa 180 Euro zahlen. Die genaue Berechnung müsse das Amtsgericht nun erneut vornehmen.
Oberlandesgericht Celle am 22. August 2014 (AZ: 10 UF 180/14)
-
Kita-Platz muss zur Verfügung gestellt werden Das Sächsische Oberverwaltungsgericht hat am 7.6.2017 entschieden (Az. 4 B 112/17), dass dem Anspruch auf Erhalt eines Betreuungsplatzes in einer Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflege ein Kapazitätsvorbehalt nicht entgegensteht. Das Gericht hat damit der Beschwerde der Antragstellerin stattgegeben und den Beschluss des Verwaltungsgerichts Leipzig vom 21. März 2017 - 5 L 121/17 - geändert.
Listenelement 1 -
Neues zum Ausbildungsunterhalt in den Abitur-Lehre-Studium-Fällen Bundesgerichtshof, Beschluss v. 3.5.2017 – XII ZB 415/16 1. Zum Ausbildungsunterhalt in den sog. Abitur-Lehre-Studium-Fällen - hier: anästhesietechnische Assistentin - Medizinstudium (im Anschluss an Senatsbeschluss v. 8.3.2017 – XII ZB 192/16 -, FamRZ 2017, 799 [m. Beitrag Born, S. 785]; Senatsurteile v. 17.5.2006 – XII ZR 54/04 -, FamRZ 2006, 1100 [m. Anm. Luthin], und BGHZ 107, 376 = FamRZ 1989, 853). 2. Die Leistung von Ausbildungsunterhalt für ein Studium des Kindes kann einem Elternteil unzumutbar sein, wenn das Kind bei Studienbeginn bereits das 25. Lebensjahr vollendet und den Elternteil nach dem Abitur nicht über seine Ausbildungspläne informiert hat, sodass der Elternteil nicht mehr damit rechnen musste, noch auf Ausbildungsunterhalt in Anspruch genommen zu werden.
Listenelement 2 -
Frau erhält Ehewohnung nach Trennung Pressemitteilung des OLG Oldenburg vom 29. Mai 2017 Wenn sich getrennte Eheleute nicht einigen können, kann die gemeinsame Wohnung einem der beiden zugesprochen werden, um eine „unbillige Härte" zu verhindern (§ 1361b BGB). Dies entschied das OLG Oldenburg kürzlich (Aktenzeichen 4 UFH 1/17 - Beschluss vom 31.01.2017 - und 4 UF 12/17 - Beschluss vom 29.03.2017 -). Eine solche Lösung komme insbesondere dann in Betracht, wenn sonst das Wohl von im Haushalt lebenden Kindern beeinträchtigt ist. Aber auch andere Fälle seien denkbar. Ehemann drohte seiner Frau Das Oberlandesgericht Oldenburg hatte im betreffenden Fall die Entscheidung des Amtsgerichts Oldenburg bestätigt, nach der die ehemalige gemeinsame Wohnung einer Ehefrau zugesprochen worden war. Der Ehemann, der zunächst aus der Wohnung ausgezogen war, hatte sich gegen den Beschluss des Amtsgerichts gewehrt. Die Zuweisung der Wohnung an seine Frau sei nicht gerechtfertigt. Diese habe ihn provoziert und wahrheitswidrig behauptet, er habe Geld von ihrem Konto abgehoben. Der Senat gab jedoch der Frau Recht: Ein weiteres Zusammenleben mit ihrem Mann wäre ihr nicht zuzumuten. Er hätte auf ihrem Anrufbeantworter eine erhebliche Drohung hinterlassen und sich gewaltsam Zugang zu der Wohnung verschafft, indem er die Terrassentür aufgebrochen habe. Im Gerichtstermin habe er auf seine frühere Tätigkeit bei einem Einsatzkommando der Polizei hingewiesen. Das Amtsgericht hatte es daher für plausibel gehalten, dass der Mann seine Drohungen auch umsetzen werde. Begründung der Entscheidung Aufgrund der Gefährdungslage für die Ehefrau sei die Zuweisung der Wohnung an diese auch verhältnismäßig, so der Senat. Dem Mann könne zugemutet werden, vorübergehend wieder bei seinen Eltern einzuziehen, bei denen er nach der Trennung bereits für einige Zeit gelebt habe. Quelle: Pressemitteilung Nr. 32/2017 des OLG Oldenburg vom 29. Mai 2017
Listenelement 3 -
Wechselmodell nicht ausgeschlossen Bundesgerichtshof, Beschluss v. 1.2.2017 – XII ZB 601/15 1. Eine gerichtliche Umgangsregelung, die im Ergebnis zu einer gleichmäßigen Betreuung des Kindes durch beide Eltern im Sinne eines paritätischen Wechselmodells führt, wird vom Gesetz nicht ausgeschlossen. Auch die Ablehnung des Wechselmodells durch einen Elternteil hindert eine solche Regelung für sich genommen noch nicht. Entscheidender Maßstab der Regelung ist vielmehr das im konkreten Einzelfall festzustellende Kindeswohl. 2. Die auf ein paritätisches Wechselmodell gerichtete Umgangsregelung setzt eine bestehende Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit der Eltern voraus (Fortführung des Senatsbeschlusses v. 15.6.2016 – XII ZB 419/15 -, FamRZ 2016, 1439 [m. Anm. Lack]). Dem Kindeswohl entspricht es daher nicht, ein Wechselmodell zu dem Zweck anzuordnen, eine Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit erst herbeizuführen. 3. Ist das Verhältnis der Eltern erheblich konfliktbelastet, so liegt die auf ein paritätisches Wechselmodell gerichtete Anordnung in der Regel nicht im wohlverstandenen Interesse des Kindes. 4. Das Familiengericht ist im Umgangsverfahren zu einer umfassenden Aufklärung verpflichtet, welche Form des Umgangs dem Kindeswohl am besten entspricht. Dies erfordert grundsätzlich auch die persönliche Anhörung des Kindes (im Anschluss an Senatsbeschluss v. 15.6.2016 - XII ZB 419/15 -, FamRZ 2016, 1439 [m. Anm. Lack]).
Listenelement 4